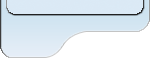|
| | |
| | Kategorie | |
Vertiefungsentwurf
|
| | Lehrstuhl | |
Lehrstuhl für Industriebauten - Prof. Dr.-Ing. Gunter Henn
|
| | Aufgabe | |
Die Aufgabe dieses Entwurfes bestand darin, eine Mietfabrik als Innovationszentrum an der Schandauer Straße in
Dresden-Striesen zu planen.Neben der Bereitstellung von flexible Mieteinheiten zur Ansiedlung von StartUp-Unternehmen
soll das Objekt zu einer Revitalisierung und hochbaulichen Weiterentwicklung des Quartiers beitragen und die
Reintegration der Industrie in den städtischen Raum fördern.
|
| | städtebauliches
Konzept | |
Das Hauptziel des Entwurfes ist die Schaffung einer neuen Mitte für das Quartier an der Schandauer Straße.
Die gewählte Parzelle an den Technischen Sammlungen, der Kirche und der Tanzschule bietet sich dafür an, da
vorhandene urbane Potentiale aufgenommen und ausgebaut werden können.
Um dieses Ziel zu verwirklichen wurden drei städtebauliche Themenbänder konzipiert. Das Schaufensterband
beinhaltet Show-Rooms, Innovationszentren oder Einkaufsmöglichkeiten.
Das Kulturband umfasst u.a.
Veranstaltungsbereiche in der Kirche, in den Technischen Sammlungen und auf dem Gelände der F6-Werke.
Das Grünband führt die Freiräume am Landgraben und an der Kirche bis zum Striesener Friedhof fort. Es schafft
ein zusammenhängendes, öffentlich zugängliches Grünsystem mit Sportmöglichkeiten und einer Innovationstestsrecke.
Aus der Überlagerung der Themenbänder ergibt sich das Bild eines Rückens südlich der Schandauer Strasse. Für den
Passanten entstehen überschaubare, räumliche Welten. Diese ermutigen dazu, neue Wege abseits der unendlich
erscheinenden Schandauer Straße zu benutzen.
|
| | Gebäudekonzept | |
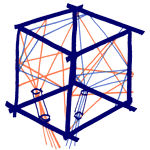 Die zentrale Idee des Entwurfs basiert auf dem Bild eines räumlichen Webrahmens. Feste Rahmenbedingungen werden mit
dem flexiblen Erkenntnisprozess im Inneren vereint, an dessen Ende die Entwicklung von Prototypen für den Markt steht.
In der baulichen Übersetzung ergibt sich ein System von massiv ausgebildeten Rahmen nach außen, die die Baustruktur
umschließen und notwendige Funktionen wie Zuarbeitsmodule, Mietflächen, Haustechnik beinhalten. Im Inneren entfaltet
sich eine Architekturskulptur, die freie, durch die Wissensträger bespielbare Flächen beinhaltet.
Aus der Arbeitsweise in einem Innovationszentrum ergibt sich eine Zweiteilung des Gebäudes in Bereiche der Kopfarbeit
und der Handarbeit d.h. der Produktion. Beide werden durch Datenleitungen, Kommunikationsbrücken als Nerven und Muskeln
des Gebäudes verbunden.
Die zentrale Idee des Entwurfs basiert auf dem Bild eines räumlichen Webrahmens. Feste Rahmenbedingungen werden mit
dem flexiblen Erkenntnisprozess im Inneren vereint, an dessen Ende die Entwicklung von Prototypen für den Markt steht.
In der baulichen Übersetzung ergibt sich ein System von massiv ausgebildeten Rahmen nach außen, die die Baustruktur
umschließen und notwendige Funktionen wie Zuarbeitsmodule, Mietflächen, Haustechnik beinhalten. Im Inneren entfaltet
sich eine Architekturskulptur, die freie, durch die Wissensträger bespielbare Flächen beinhaltet.
Aus der Arbeitsweise in einem Innovationszentrum ergibt sich eine Zweiteilung des Gebäudes in Bereiche der Kopfarbeit
und der Handarbeit d.h. der Produktion. Beide werden durch Datenleitungen, Kommunikationsbrücken als Nerven und Muskeln
des Gebäudes verbunden.
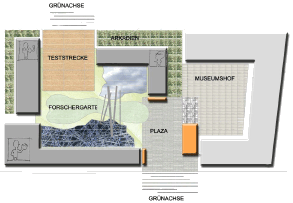 Weitere Rahmungen werden durch einen neuen Fitnessbaukörper, die Technischen Sammlungen sowie durch Präsentationsboxen
aufgespannt. Die Integration dieser öffentlichen Potentiale trägt dazu bei, das Innovationszentrum nicht als isolierte
Struktur sondern als Beitrag zur Stadtentwicklung zu begreifen.
Weitere Rahmungen werden durch einen neuen Fitnessbaukörper, die Technischen Sammlungen sowie durch Präsentationsboxen
aufgespannt. Die Integration dieser öffentlichen Potentiale trägt dazu bei, das Innovationszentrum nicht als isolierte
Struktur sondern als Beitrag zur Stadtentwicklung zu begreifen.
Zwischen den Baukörpern werden verschiedene Freiraumsituationen wie eine Plaza, ein Forschergarten oder die Testsrecke
implantiert. Durch dieses entstehende Ensemble wird der Besucher entlang von Lichtstelen hindurchgeleitet.
|
| | Grundrisse und
Prozessorganisation | |
Der Rahmen des Wissensbaukörpers beinhaltet im Erdgeschoss öffentliche Funktionen wie Existenzgründerberatung
oder Pressedienst. In den oberen Etagen erfolgt eine Abstufung von Einsteigerarbeitsplätzen, über Forschungs-
und Entwicklungsbüros für etablierte Firmen bis hin zur Bürowerkstatt als erster experimenteller Kreativbereich.
Die Wissensskulptur eröffnet großzügige Galerien u.a. für Denkerzellen oder Recherchezonen.
Im Gebäuderahmen des Produktionsbaukörpers erfolgt die Anlieferung. Der Vertikaltransport wird durch ein
intelligentes Hochregallager, der Horizontaltransport der Materialien, sowie die Medienverteilung über eine
Straße im Rahmeninneren gewährleistet. Diese Organisation ermöglicht eine flexible Installationsführung
in die Zuarbeitsmodule und Trockenlabore, die zur Schandauer Straße hin angeordnet sind.
In der Produktionsskulptur befindet sich der Montage- und Fügungsbereich, der ebenfalls frei unterteilbar ist.
In den Obergeschossen beider Bauten sind Mitarbeitererholung, Cafeteria und Dachterrassen vorgesehen, die durch
einen offenen Skywalk miteinander verbunden werden.
In den Gebäudegelenken und -endpunkten befinden sich Fluchttreppenhäuser, Sanitäranlagen und die Haustechnik.
Wichtigstes Verbindungselement zwischen beiden Gebäuden ist die gläserne Hauptbrücke zwischen Forschungswerkstatt
und Recherchebereich.
|
| | Gestaltungskonzept | |
Die verwendeten Baumaterialien und die Farbgestaltung des gebäudes sollen die Metapher des Webrahmens unterstreichen.
So sind die Rahmenbereiche durch grobe Sichtbetonkerne mit kleinen Fensteröffnungen und großflächige
Aluminiumgitterstrukturen verdeutlicht.
Das Gitter erscheint je nach Betrachtungswinkel massiv bis durchlässig, ermöglicht dennoch eine gleichmäßige
Belichtung der Innenräume. Gleichzeitig wird die Proportionierung der Fassade bewusst versteckt, um nicht in
Konkurrenz zur feinen Gliederung der Technischen Sammlungen und anderer umliegender Bestands-Bauwerke zu treten
und um den eigentlichen Aha-Effekt im Inneren der Parzelle vorzubereiten.
Die Hartnäckigkeit des Rahmens wird durch ein Spiel mit liegenden Fensterbändern, durch Holzdachterrassen und
durch Holzschaufenster im Erdgeschoss unterbrochen.
Gläserne Schauboxen stellen farbige Akzente am Eingangsbereich in das Gelände dar und dienen als exklusive
Präsentationsflächen für Innovationszentrum und Museum.
Im Gegensatz zum geschlossenen Rahmen erscheint die innere Skulptur als transparenter Kristall aus Stahl und Glas.
Durch die Fortführung des Stelenmotivs aus dem Außenraum in Fassade und Gebäudeinneres werden Innen- und Außenraum
miteinander verwoben.
|
| | Bearbeitung | |
Tini Nowotny, Sebastian Schild
|
| 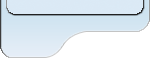 | | |


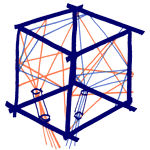 Die zentrale Idee des Entwurfs basiert auf dem Bild eines räumlichen Webrahmens. Feste Rahmenbedingungen werden mit
dem flexiblen Erkenntnisprozess im Inneren vereint, an dessen Ende die Entwicklung von Prototypen für den Markt steht.
In der baulichen Übersetzung ergibt sich ein System von massiv ausgebildeten Rahmen nach außen, die die Baustruktur
umschließen und notwendige Funktionen wie Zuarbeitsmodule, Mietflächen, Haustechnik beinhalten. Im Inneren entfaltet
sich eine Architekturskulptur, die freie, durch die Wissensträger bespielbare Flächen beinhaltet.
Aus der Arbeitsweise in einem Innovationszentrum ergibt sich eine Zweiteilung des Gebäudes in Bereiche der Kopfarbeit
und der Handarbeit d.h. der Produktion. Beide werden durch Datenleitungen, Kommunikationsbrücken als Nerven und Muskeln
des Gebäudes verbunden.
Die zentrale Idee des Entwurfs basiert auf dem Bild eines räumlichen Webrahmens. Feste Rahmenbedingungen werden mit
dem flexiblen Erkenntnisprozess im Inneren vereint, an dessen Ende die Entwicklung von Prototypen für den Markt steht.
In der baulichen Übersetzung ergibt sich ein System von massiv ausgebildeten Rahmen nach außen, die die Baustruktur
umschließen und notwendige Funktionen wie Zuarbeitsmodule, Mietflächen, Haustechnik beinhalten. Im Inneren entfaltet
sich eine Architekturskulptur, die freie, durch die Wissensträger bespielbare Flächen beinhaltet.
Aus der Arbeitsweise in einem Innovationszentrum ergibt sich eine Zweiteilung des Gebäudes in Bereiche der Kopfarbeit
und der Handarbeit d.h. der Produktion. Beide werden durch Datenleitungen, Kommunikationsbrücken als Nerven und Muskeln
des Gebäudes verbunden.
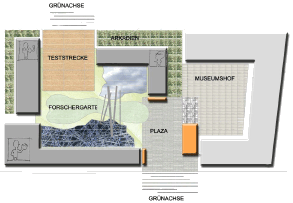 Weitere Rahmungen werden durch einen neuen Fitnessbaukörper, die Technischen Sammlungen sowie durch Präsentationsboxen
aufgespannt. Die Integration dieser öffentlichen Potentiale trägt dazu bei, das Innovationszentrum nicht als isolierte
Struktur sondern als Beitrag zur Stadtentwicklung zu begreifen.
Weitere Rahmungen werden durch einen neuen Fitnessbaukörper, die Technischen Sammlungen sowie durch Präsentationsboxen
aufgespannt. Die Integration dieser öffentlichen Potentiale trägt dazu bei, das Innovationszentrum nicht als isolierte
Struktur sondern als Beitrag zur Stadtentwicklung zu begreifen.