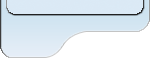Konzept
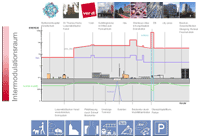 |
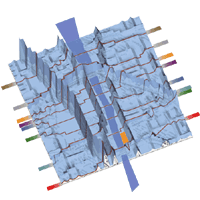 |
 Aus den vorhandenen Potentialen, den Mobilitätsenergien und Kommunikationswahrscheinlichkeiten
ergab sich ein typischer Charakter für jeden Schnitt, die durch konzeptionelle städtebauliche
Maßnahmen weiter kultiviert und verstärkt werden sollten.
So ensteht insgesamt ein Bild punktueller Interventionen, die wie Beeren an den Stadtschnitten
hängen. Verbindendes Element der Einzelschnitte sind die Spree und die wichtigen Mobilitätsachsen
Strahlauer Straße und Köpenicker Straße sowie die Bahntrasse. Über diese Achsen erfolgen
Energieumwandlungen und Synergieeffekte zwischen den Schnitten - sie sind Innovationsflüsse der Stadt.
Aus den vorhandenen Potentialen, den Mobilitätsenergien und Kommunikationswahrscheinlichkeiten
ergab sich ein typischer Charakter für jeden Schnitt, die durch konzeptionelle städtebauliche
Maßnahmen weiter kultiviert und verstärkt werden sollten.
So ensteht insgesamt ein Bild punktueller Interventionen, die wie Beeren an den Stadtschnitten
hängen. Verbindendes Element der Einzelschnitte sind die Spree und die wichtigen Mobilitätsachsen
Strahlauer Straße und Köpenicker Straße sowie die Bahntrasse. Über diese Achsen erfolgen
Energieumwandlungen und Synergieeffekte zwischen den Schnitten - sie sind Innovationsflüsse der Stadt.
Die zentrale Idee des Entwurfs basiert auf der Anwendung des Schnittmotivs auf die Gebäudeform: Aus der Gliederung des Raumprogramms in die Bereiche Stadt, Produktion, Forschung & Entwicklung sowie Design ergeben sich vier thematische Gebäudeschnitte. Der Viktoria Speicher, zur NS-Zeit auch als Depot für entartete Kunst genutzt, wird als fünfter Schnitt in das Ensemble integriert und soll neben Ausstellungsflächen auch freie Ateliers, eine Werbeagentur und den Bistro- und Restaurantbereich für das gesamte Entwicklungszentrum beherbergen.
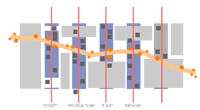 |
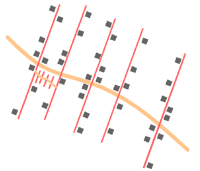 |
Als Äquivalent der Spree werden die Gebäudeschnitte durch einen Innovationsfluss verbunden. Seine Form aus symbolischen Mäandern, Aufweitungen und Stromschnellen steht für die Bündelung der Wissensenergie im Gebäudeinneren. In der baulichen Übersetzung entfaltet sich eine Architekturskulptur als dynamisch geformte Membrankonstruktion, die die massiven Gebäude durchfließt oder überspült. Entlang dieses Flusses, der als öffentliche Promenade einer natürlichen Wegebeziehung zwischen Kreuzberg und der Schillingbrücke folgt, befinden sich wichtige öffentliche Nutzungen und Sonderfunktionen in Kieselsteinen. Diese gliedern den Weg der Besucher und Forscher.
In der Iteration der städtebaulichen Figur aus Stadtschnitten und Flusslauf kann der Entwurf als Fraktal der Gesamtstadt im kleinen Maßstab aufgefasst werden.
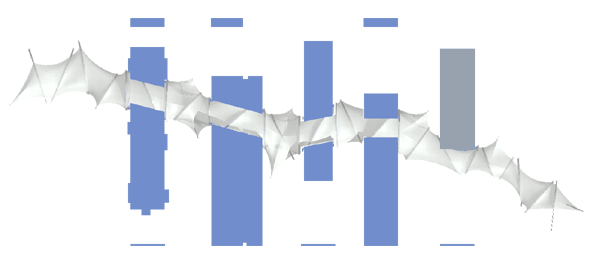
Prozessorganisation
Auf der einen Seite gibt es den Innovationsfluss als öffentliche Promenade mit hoher Kommunikation und Dynamik. In dessen Erdgeschoss befinden sich die wichtigsten öffentlichen Erlebnisbereiche wie Stadtteil-Office, Verkaufs- und Multimediaflächen, Testboxen, Seminarbereiche sowie ein Cafe.
Im Gegensatz zum langsamen Flanieren der Besucher im Erdgeschoss findet in den oberen Galerieebenen der schnelle Austausch der Mitarbeiter und Forscher zwischen den Abteilungen statt. Dort befinden sich die wichtigsten Kommunikationsbereiche der Forscher, wie u.a. Recherchezonen, Treffpunkte und Datenbanken.
Auch die Teststrecke, auf welcher Besucher und Kunden die entwickelten Stadtmobile vor Ort ausprobieren können, wird als eigene Ebene in den Innovationsfluss integriert.
Neben den beiden Haupteingängen des Gesamtkomplexes wurden im Innovationsfluss zahlreiche Seiteneingänge vorgesehen, die den Besuchern die Möglichkeit geben, die einzelnen Erlebnisräume schnell zu erreichen und den Innovationsfluss zur Spree hin zu durchqueren. Die Mitarbeiterzugänge befinden sich hingegen in den Stirnseiten der Gebäude. Parkmöglichkeiten - sowohl für Besucher als auch für Mitarbeiter - wurden im gläsernen Hochregallager und im Anlieferungshof vorgesehen.
Auf der anderen Seite sind die geschlossen gestalteten Gebäude eher als Konzentrations- und Arbeitsbereiche für die Forscher und Mitarbeiter zu sehen.
Der zur Schillingbrücke gerichtete Stadtkörper beinhaltet im Erdgeschoss öffentliche Funktionen wie Stadtforschung sowie Pressedienst und Öffentlichkeitsarbeit. In den oberen Etagen befinden sich Entwicklungsbüros der Mobilitätsforschung, des Mobilitätsmanagements sowie Verwaltungsflächen und technische Dienste. Die interne Erschließung erfolgt über die Galerie-Mittelzonen, die durch Oberlichter und Gemeinschaftsflächen wie Hot Desk, Kopierstation oder eine Sky Box zur Erholung strukturiert sind. Neben den Bürobereichen wurden Optionsflächen für die temporäre Mitarbeit anderer Fachabteilungen vorgesehen. Außerdem wurde eine Studenten Area als experimenteller Kreativbereich konzipiert.
Der Produktionsbaukörper beinhaltet mit der Metallverarbeitung, den Testboxen zur Qualitätskontrolle, der Kunststoffbearbeitung, der Elektronik-Fertigung, den Ausbaukomponenten sowie einer Forschungswerkstatt die eigentlichen Montagebereiche des Zentrums. Diese greifen wie die integrierte Werkstatt zu Restaurierung von Liebhaber-Fahrzeugen auf ein intelligentes Hochregallager für Warentransport und -lagerung zurück.
Nutzungen wie Grundlagenforschung, Marktforschung und Laborarbeit finden im Körper Forschung & Entwicklung statt. Um eine großzügige Mittelzone sind einerseits Trockenlabore und Testboxen mit Schreibplätzen, andererseits Büroflächen angeordnet. Die Seminarbereiche und ein virtueller Simulationsraum als eher öffentliche Nutzungen schließen den Forschung & Entwicklunskörper zum Innovationsfluss hin ab.
Gegenüber den Atelierbereichen des Viktoria Speichers ist das Design angesiedelt. Abgesehen von einem mittig gelegenen Technikriegel und den Werkstattbereichen ist die Nutzfläche frei bespielbar. So kann diese mit Atelierboxen oder Denkerzellen frei möbliert werden.
Über die Designforschung mit angegliederter Car-Klinik und die Einblicke in die Designbereiche wird auch hier die Öffentlichkeit stark integriert.
So soll die Zusammengehörigkeit aller Gebäude zu einer Familie durch das Auftreten gemeinsamer Elemente verdeutlicht werden. Alle Gebäude erscheinen als langgestreckte Quader mit zurückgesetzter, transluzenter Sockelzone. Ein Klarglasband in Schreibhöhe, welches Ein- und Ausblicke bietet sowie die horizontale Fassadengliederung betonen das liegende Format. Blech- und Gitterfassaden sowie gläserne Bereiche sind Vertreter eines Farb- und Materialspektrums.
Die Hartnäckigkeit der Blech- und Gitterfassaden wird durch farbige Akzente unterbrochen, die die Eigenständigkeit jedes Körpers unterstreichen. Ähnlich einer Evolution werden diese von Gebäude zu Gebäude weiter vererbt und unterliegen dabei einer Wandlung.
Der Stadtkörper besitzt eine spielerische Blechfassade, die durch frei angeordnete farbige Schauboxen strukturiert ist. Auch die Fensteröffnungen mit Schiebelementen zur Verschattung wurden spielerisch angeordnet. Dadurch soll der Variationsreichtum innerhalb der Stadt symbolisiert werden.
Die weit aus der Fassade hervorragenden Betonschauboxen werden an die Produktion weiter vererbt, allerdings als langgestreckte rationale Schaufensterbänder im Erdgeschoss. Die Fassade der Produktion besteht zwar ebenfalls aus Blechpaneelen, diese weisen jedoch größere Formate und eine rationalere Anordnung auf.
Das Regalsystem des gläsernen Hochregallagers präsentiert sowohl Rohmaterialien als auch fertige Automobile und die Fahrzeuge der Mitarbeiter und Kunden. Sein sich ständig veränderndes Erscheinungsbild steht für die sich ständig wandelnden Mobilitätskonzepte der Stadt. Die Schaufensterbänder der Produktion sind nun in die Ebene projiziert und erscheinen nur noch als farbige Glasflächen in der Fassade. Die strichcodeartige Bedruckung steht symbolhaft für die Erfassung der Waren im Inneren.
Der Körper Forschung und Entwicklung erscheint als Black Box, die ihr gläsernes Inneres erst beim Betreten preisgibt. Das Aluminiumgitter ermöglicht dennoch eine gleichmäßige Belichtung der Innenräume. Farbige Gitterelemente stellen die nächste Evolutionsstufe vom Hochregallager aus dar.
Das Design schließlich präsentiert sich als Glaskörper, der durch dichte Blechlamellenstellungen gegliedert wird. Vorgesetzte Bilderrahmen stehen für den Kreativprozess im Inneren. Sie können durch Leinwände bespannt werden und dienen als flexible Bildträger und Präsentationstafeln.
Im Gegensatz zu den statischen, klaren Gebäuden, die für die konzentrierte Arbeit innerhalb der Fachabteilungen stehen, erscheint der Innovationsfluss als dynamische, weiche Raumskulptur. Unter der leichten Haut aus einem PTFE beschichteten Glasfasegewebe sollen Kommunikations- und Synergieeffekte gebündelt werden. Die beschichtete Membran reduziert den Anteil des durchgelassenen natürlichen Lichts wodurch ein blendfreier, jedoch heller, gleichmäßig beleuchteter Innenraum entsteht, der als sehr angenehm empfunden wird. Die Hauptzugänge und die seitlichen Eingänge in das Zelt werden durch Pylone und Klarglasfassaden markiert. An den Schnittpunkten zwischen dem Innovationsfluss und den Gebäuden wird die Blechfassade der Körper zugunsten einer Glasfassade aufgebrochen. Einige Blechelemente verbleiben jedoch fragmentarisch im Inneren als Fassadenakzente.
Das Tragsystem der massiven Gebäudekörper besteht aus einer Stahlbetonverbundkonstruktion, welche durch die massiven Haustechnik- und Fluchtreppenhauskerne horizontal ausgesteift wird. Die Abtragung der Lasten erfolg über Stahlverbundstützen und Unterzüge, die in unterschiedlichen Rastermaßen unter den Deckenplatten vorgesehen wurden.
Im Gegensatz dazu wurde für den dynamischen Innovationsfluss eine leichtere Konstruktion als Tragstruktur gewählt. So bestehen die Tragbögen des Innovationsflusses aus stählernen Dreigurtbindern, welche unterschiedlich Spannweiten und Abstände zueinander aufweisen und die PTFE-beschichtete Glasfasermembran als äußeren Raumabschluss tragen. Bogeneinspannungen am Anfang und Ende des Zeltes steifen die Gesamtkonstruktion aus. Die Eingänge werden durch eingespannte und ausbetonierte Stahlpylone markiert. Die konkrete Umsetzung der Dachmembrananschlüsse variiert, je nachdem, ob die Membran an die Dreigurtbinder, die Fassaden der Gebäude beziehungsweise mittels einer inneren Membran an die Seiteneingänge angebunden werden soll.
Brandschutzaspekte
Alle Gebäudebereiche sind durch DIN gerechte Fluchtwege im Radius von 30m erschlossen. Sämtliche Primärtragsysteme erfüllen die Brandschutzanforderungen F90. Brandschutztechnische Gefahrenpunkte werden durch eine Kombination von Sicherungsmaßnahmen (Sprinkleranlagen, Rauchmelder, usw.) entschärft. Außerdem kann die Feuerwehr alle Punkte des Areals durch befahrbare Beläge und die an den Zelteingängen gewährleistete Durchfahrtshöhe erreichen.
Der Innovationsfluss ist durch F90-Fassadensysteme brandschutztechnisch von den Gebäuden abgekoppelt und ebenerdig erschlossen. Das Stahltragwerk wird mit einem Brandschutzanstrich versehen, die PTFE-Glasfasermembran ist nach DIN 4102 als nichtbrennbares Material A2 ausgewiesen. Darüber hinaus sind Membrankonstruktionen immer noch als Sonderbauwerke einzustufen und nicht vollständig von DIN Normungen erfasst. So sollte ein detailliertes Brandschutzkonzept u.a. in den Galeriebereichen individuell mit Fachplanern abgestimmt werden. Denkbar wäre ein Verbot von Brandlasten in Erschließungsbereichen, sowie eine Kombination von Sicherungsmaßnahmen (Sprinkleranlagen, Rauchmelder, usw.)
Bauklimatik und Gebäudetechnik
Das Gelände ist über zentrale Versorgungsleitungen unter der Köpenicker Straße bzw. unter den Spreebrücken vollständig erschlossen.
Da der vorhandene hohe Grundwasserstand eine unterirdische Medienführung erschwert, wurden oberirdische Technikkerne und Schächte konzipiert, welche zusammen mit den horizontalen Leitungsführungen unterhalb der Rohdecken und Galeriebrücken die Medienverteilung innerhalb der Gebäude übernehmen.
Aufgrund der unterschiedlichen Raumprogramme jedes Gebäudes wurden dezentrale Haustechnikbereiche und individuelle Heizungs- und Lüftungssysteme geplant. Für die Gewährleistung des sommerlichen Wärmeschutzes erweisen sich die geschlossenen Gebäudefassaden und die massiven Kerne und Deckenplatten des Tragsystems als besonders günstig. So können alle Gebäuden - abgesehen von der Produktion mit ihren höheren Wärmemengen und großen Raumtiefen - natürlich belüftet werden.
Im Winter hingegen kommt dem gläsernen Hochregallager eine besondere Bedeutung zu. Die darin solar erwärmte Luft, die anschließend aufbereitet und dem Luftkreislauf zugeführt werden kann, trägt dazu bei, den Energieverbrauch der Heizung zu minimieren.
Bei den bauklimatischen Betrachtungen lag ein besonderes Augenmerk auf der Umsetzung des Innovationsflusses. So fungiert der Raum unter der Membran als Zwischenklima, dessen Temperatur etwa 3 Kelvin über der Außentemperatur liegen dürfte. Um bauklimatischen Extremen in den Sommermonaten entgegenzuwirken, wurden Zuluftöffnungen entlang der Fußpunkte der Membrankonstruktion vorgesehen. Entsprechende Abluftöffnungen konnten mittels einer öffenbaren Verglasung in die oberen Abschlüsse der Bogenbinder integriert werden. Durch den so entstehenden Höhenunterschied kann im Sommer der Kamineffekt zur natürlichen Be- und Entlüftung genutzt werden. Lediglich die im Zelt befindlichen Kieselsteine, welche im Winter mit der Abluft aus den Gebäuden beheizbar sind, müssen mit einer künstlichen Lüftung versehen werden, da unter dem Zelt keine ausreichenden Druckdifferenzen auftreten.
Barrierefreiheit
Alle Gebäudebereiche sind barrierefrei zugänglich. Behindertengerechte Sanitäranlagen befinden sich im Stadtkörper sowie in der Forschung und Entwicklung und im Design. In die oberen Geschosse gelangt man über Liftsysteme. Auf dem Kundenparkplatz. befinden sich zwei behindertengerechte Parkierungsmöglichkeiten.
Denkerzellen in den Recherche- und Atelierbereichen stehen für das flexibel nutzbare, mobile Büro der Zukunft. Auch die Produktionsbereiche stellen weitere Einsatzgebiete dieses Systems dar, falls in diesen Schreibarbeiten verrichtet werden müssen. Die Denkerzellen bestehen aus einer Aluminiumrahmenkonstruktion mit einer Bespannung aus intelligenten Textilen als Raumabschluss. Im Innenbereich befindet sich ein PC-Arbeitsplatz und eine Medienschiene, die an Auslässe im Installationsfußboden angeschlossen werden kann. Durch die gelenkig ausgebildeten Rahmen des Multioffice entstehen größere, nutzerspezifisch ausgebildete, beliebig addierbare Arbeitsflächen.
Das Tragwerk der im Innovationsfluss liegenden Kieselsteine besteht aus Stahlstützen und Stahlträgern in den Deckenebenen. Die Stahlprofile sind gedämmt und nehmen ebenfalls die Medienführung auf. Der innere und äußere Raumabschluss wird durch gepresste und in Form gebogene Holzwerkstoffe gebildet, die auf einer Lattung angebracht sind. Drehbare Türelemente öffnen die Sonderelemente je nach Bedarf zum Innovationsfluss.